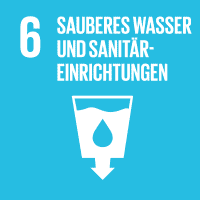„Sanitation for Millions“ ist ein globales Programm, das den Zugang zu sicheren sanitären Einrichtungen und Hygiene verbessert. Es wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) initiiert. Zu der Finanzierung haben außerdem die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, der britische Solidaritätsfonds Water Unite, das ungarische Ministerium für Äußere Angelegenheiten und Außenhandel und die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank beigetragen. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH führt „Sanitation for Millions“ mit lokalen Partnern in Uganda, Jordanien, Kolumbien und Pakistan durch.
Ziemlich beste Freunde
Elvis und Brian stellen ihre Schule in Uganda vor. Hier können alle lernen, ob mit oder ohne Behinderung. So geht Inklusion.
Elvis Paul Odong sitzt im Schatten und wartet. Sein Freund Brian Anok ist losgegangen, um das Mittagessen für beide zu holen, damit Elvis in der Zwischenzeit schon berichten kann. „Ich kann nicht gut sehen“, sagt der 12-Jährige. Besonders schwer falle es ihm, in die Ferne zu schauen. Aber es hindert ihn nicht daran, eifrig zu lernen. Auch, weil er Brian an seiner Seite weiß.
Die beiden Jungen sind zwei von rund 600 Schülerinnen und Schülern an der staatlich geförderten Ikwera-Negri-Schule im Norden von Uganda. Hier in Apac, gut fünf Autostunden von der Hauptstadt Kampala entfernt, setzen sie schon seit langem auf Inklusion. Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung besuchen die Grundschule, die – wie in Uganda üblich – nach Klasse sieben endet.
Seit mehr als 30 Jahren arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer von Ikwera Negri dafür, dass wirklich alle ihr Recht auf Bildung bekommen. Voller Überzeugung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. „Wir sind Vorreiter“, bestätigt Direktorin Janet Lydia Ajwang. „Noch vor wenigen Jahren galt es in Uganda als Verschwendung von Ressourcen, ein Kind mit Behinderung in die Schule zu schicken.“
Die Grundschule wurde 1983 von Nonnen als Bildungseinrichtung für Kinder mit Behinderungen gegründet. Weil es in der ländlichen Region insgesamt zu wenig Schulplätze gab, wurden nach und nach auch Kinder ohne Behinderungen aufgenommen. 1989 übernahm die Regierung die Schule mit angeschlossenem Internat.
Unterkünfte sind besonders für die Kinder wichtig, deren Familien weiter weg wohnen oder über wenig Geld verfügen. Die Schule bietet auch Verpflegung, Freizeitangebote und hygienische Versorgung an. Auf dem Areal konnten mit Unterstützung des globalen Programms „Sanitation for Millions“ die sanitären Anlagen ausgebaut werden. Es gibt Toiletten mit barrierefreiem Zugang und mehrere Waschgelegenheiten. Um die Mittagszeit ist dort viel los, weil sich alle schnell noch die Hände waschen wollen, ehe sie fürs Essen anstehen.

Brian ist inzwischen mit zwei Tellern zurückgekommen und setzt sich zu Elvis in den Schatten des Schulgebäudes. Es gibt Schwarzaugenbohnen und den Maisbrei Ugali.
Während die beiden Jungen sich stärken, beschreibt Brian seinen Freund: „Elvis ist warmherzig und bescheiden.“ Durch ihn habe er gelernt, geduldiger zu sein. Mit anderen, aber auch mit sich selbst. Große Worte macht der Teenager nicht, aber die Verbundenheit ist spürbar.
Elvis wiederum ist froh über Brians Hilfsbereitschaft. „Manchmal schmerzen meine Augen so sehr, dass ich nicht zum Unterricht kommen kann.“ Sein Freund mache dann jedes Mal Notizen für ihn und erkläre im Nachhinein den Unterrichtsstoff. Er übernehme das gern, erwidert Brian: „Ob mit oder ohne Behinderung, letztlich sind wir alle gleich – jeder hat doch etwas, wobei er Unterstützung braucht.“
Für die beiden Jungen ist Solidarität selbstverständlich, sie erleben und leben sie in ihrer Schule. Doch das war und ist nicht überall so. In den Dörfern der Gegend seien sie anfangs auf große Vorbehalte gestoßen, berichtet Schulleiterin Ajwang. Menschen mit Behinderungen wurden oft zu Hause abgeschottet, Unterricht für sie galt als rausgeworfenes Geld. In diesem Umfeld hätten sich Eltern für ihre Töchter und Söhne geschämt: „Ich habe oft beobachtet, dass sie nach den Ferien nicht bis zum Schultor mitkamen, sondern etwas entfernt zurückblieben, um nicht zusammen mit ihren Kindern gesehen zu werden.“
Doch das gemeinsame Lernen von Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung habe inzwischen in die Region um die Schule ausgestrahlt. Die Akzeptanz werde größer. Das beginne in den Familien und ziehe Kreise. Inzwischen zeigten sich Eltern häufiger mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit. Aber die Schulleiterin bleibt realistisch: Immer noch würden Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt und versteckt.

Gemeinsame Aufgabe Inklusion
Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit leben mit Behinderungen, gut 80 Prozent von ihnen in Ländern mit niedrigen Einkommen. 2006 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Behindertenrechtskonvention. Ihr Zweck: Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle behinderten Menschen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Auch die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zielt auf die Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung – etwa bei der Bildung.
Die Schule wirbt dafür, dass sich diese Einstellung ändert. Mit Erfolg findet Thomas Omara Sanfan. Er leitet den Eltern-Lehrer-Verband und hat all seine Kinder auf die Ikwera Negri Schule geschickt. Keines der vier hat eine Behinderung. „Ich möchte, dass meine Kinder mit denen, die eine Behinderung haben, zusammenleben“, betont er. „Mit etwas Unterstützung können sich alle sehr gut entwickeln und Aufgaben für die Gesellschaft übernehmen“.
Aber es müsse noch mehr getan werden, da sind sich Schulleitung und Eltern-Lehrer-Verband einig. „Wenn die Kinder mit Behinderung in den Ferien in ihre Dörfer fahren, stoßen sie dort oft noch auf die alte Ablehnung“, bedauert Sanfan. „Wie sehr sie das belastet, spüren wir, wenn sie wieder in den Klassen sind“, berichtet die Pädagogin Ajwang. Zum Schulanfang seien die Kinder erst einmal wieder stiller und zurückhaltender.
Brian und Elvis kicken nach dem Mittagessen noch eine Runde auf dem Fußballfeld. Brian kündigt an, wenn der Ball kommt. Elvis nimmt ihn geschickt an und kickt ihn zurück. Ein ganz normaler Zeitvertreib, bevor die beiden in den Klassenraum zurückkehren. Und als beste Freunde stecken beide auch in der Schulstunde gleich wieder ihre Köpfe zusammen.