Bei der UN-Biodiversitätskonferenz COP16 stand die Umsetzung des Globalen Biodiversitätsrahmens im Vordergrund. Vertragsstaaten legten ihre neuen nationalen Biodiversitätsziele bzw. -strategien vor. Um Fortschritte beim Erreichen der Ziele besser überprüfen zu können, einigte man sich dafür auf feste Kriterien („Monitoring Framework“). Die Vertragsstaaten beschlossen zudem, wie langfristig mehr Mittel für die Biodiversität aufgebracht werden können. Dazu haben sie neben dem bestehenden „Global Biodiversity Framework Fund“ mit dem „Cali Fund“ einen weiteren internationalen Finanzierungsmechanismus ins Leben gerufen. Er soll künftig einen Ausgleich für die Nutzung von sogenannten digitalen Sequenzinformationen schaffen. Das sind genetische Informationen aus Organismen, die eine Schlüsselrolle zum Beispiel für die Pharma- oder Chemieindustrie spielen. Entwicklungsländer waren an den Gewinnen daraus bisher kaum beteiligt. Über den neuen Cali-Fonds, in den Unternehmen einzahlen sollen, die von diesem Naturschatz profitieren, können Entwicklungsländer künftig besser an den Erlösen teilhaben. Schließlich haben indigene Völker und lokale Gemeinschaften ein festes Gremium im Konventionsprozess erhalten, der ihre Rolle für den Erhalt von Biodiversität anerkennt und stärkt.
 Tapash Paul
Tapash Paul
„Die Natur interessiert sich nicht für Geopolitik“
Biodiversität ist für unsere Zukunft entscheidend und sollte nicht von der internationalen Agenda fallen. Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt schauen wir mit GIZ-Biodiversitätsexpertin Silke Spohn darauf, wie es um die Artenvielfalt steht.
Die politische Weltkarte ändert sich – und mit ihr die Prioritäten. Geopolitische Aspekte und Wirtschaftsfragen beherrschen derzeit die internationale Debatte. „Das ist in Ordnung und wichtig“, sagt Silke Spohn, Leiterin des GIZ-Sektorvorhabens Biodiversität-Umwelt-Meere. „Aber Biodiversität darf nicht vergessen werden. Denn die Natur interessiert sich nicht für Geopolitik.“
Tatsächlich gehen das Artensterben und der Verlust von Ökosystemen unvermindert weiter: Die Korallen bleichen in bisher ungekanntem Maße aus; Wälder vertrocknen; Wildtierbestände nehmen dramatisch ab; Pilzarten gehen verloren; Fisch- und Vogelbestände schwinden. Der Mensch greife in „beispielloser“ Weise in die biologische Vielfalt ein, hieß es erst vor kurzem in einer Metastudie der Universität Zürich, die fast 100.000 Standorte auf allen Kontinenten berücksichtigt hat.
Mit den USA fällt ein entscheidender Finanzier weg
Zur neuen weltpolitischen Realität gehört auch, dass die USA unter Präsident Donald Trump die Entwicklungsorganisation USAID faktisch aufgelöst haben und die amerikanischen Gelder für Biodiversität entfallen werden. Bisher zählten die Vereinigten Staaten zu den größten Gebern für den Naturschutz in Entwicklungsländern. Dort ist häufig reiche Biodiversität zu finden, etwa in den tropischen Wäldern des Kongos, der Anden oder am Südhang des Himalayas. Gleichzeitig bleibt für den Schutz dieser wichtigen Ökosysteme meist wenig Geld in staatlichen Budgets übrig. Deshalb sind internationale Mittel besonders wichtig. Vor diesem Hintergrund ist der Wegfall der USA als Finanzier ein echtes Problem. Und noch ist völlig unklar, von wem diese Lücke gefüllt werden könnte.
„Es wäre kurzsichtig, dem amerikanischen Beispiel zu folgen und den Biodiversitätserhalt auf breiter Front runterzufahren“, so Spohn. „Im Gegenteil: Eigentlich wären noch mehr Mittel nötig.“ Denn fast alles, was wir als Menschen brauchen, kommt aus der Natur – Nahrung, Rohstoffe, Medikamente, Wasser, Luft, auch die Regulierung des Klimas. Etwa drei Viertel aller Antibiotika sind zum Beispiel natürlichen Ursprungs, genauso wie knapp zwei Drittel aller Zytostatika, die vor allem für Chemotherapien gegen Krebs eine entscheidende Rolle spielen. Häufig kommen die natürlichen Rohstoffe dazu aus Entwicklungsländern, wie zum Beispiel ein 2011 auf den Markt gebrachtes Krebsmedikament, das auf Meeresschnecken und Blaualgen aus den Gewässern vor Mauritius zurückgeht.
 privat
privat
Silke Spohn leitet das Sektorvorhaben „Biodiversität-Umwelt-Meere“ in der GIZ.
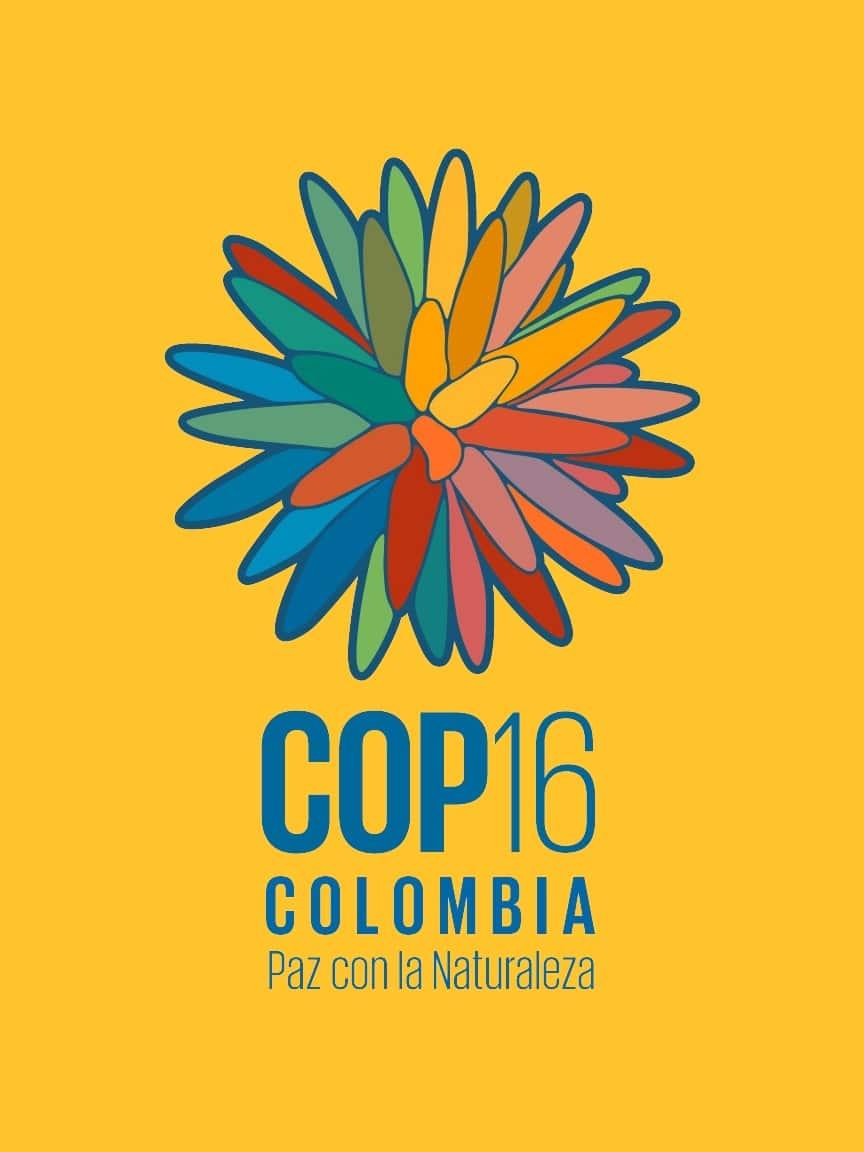
Naturprodukte aus anderen Weltgegenden für Deutschland wichtig
Gerade Deutschland ist bei seinen Lieferketten in hohem Maß auf Ökosysteme und Naturprodukte aus anderen Weltgegenden angewiesen. „Bei Kaffee, Kakao, Früchten und Nüssen ist das noch ziemlich offensichtlich“, sagt Spohn, „aber das gilt auch für viele Gewürze, Naturkautschuk, Baumwolle, Holz und verschiedene Mineralien.“ Vieles davon wird in Deutschland weiterverarbeitet oder veredelt und schafft neben Versorgungssicherheit auch Arbeitsplätze. Umgekehrt sieht das Weltwirtschaftsforum mehr als die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung durch den Niedergang der Natur gefährdet. Die Weltbank hat errechnet, dass ab 2030 etwa 2,7 Billionen US-Dollar pro Jahr an globaler Wertschöpfung durch Biodiversitätsschwund verloren gehen. Schon aus Eigeninteresse sollten deshalb auch Naturräume und Ökosystemleistungen wie Bestäubung in fernen Ländern intakt bleiben und entsprechend von Deutschland gefördert werden.
Mit dem „Global Biodiversity Framework “ haben sich im Jahr 2022 die 196 Vertragsparteien der Biodiversitätskonvention 23 neue, konkrete Ziele gesetzt. Dieser Rahmen wurde unlängst bei der Vertragsstaatenkonferenz (COP) 16 in Cali und Rom durch weitere zentrale Beschlüsse verstärkt. „Das alles sind Meilensteine im internationalen Biodiversitätserhalt; wichtig ist nun, diese Entscheidungen auch tatkräftig umzusetzen.“
Deutschland, bisher mit Frankreich, der EU und den USA ein großer Geldgeber in Sachen Biodiversität, hat wie so viele Staaten derzeit ebenfalls mit Budgetrestriktionen zu kämpfen. Umso erfreulicher ist es laut Spohn, dass sich im Koalitionsvertrag folgender Satz findet: „Den internationalen Biodiversitätsschutz werden wir fortführen“, auch wenn noch unklar ist, was das genau bedeutet. Dem Thema weniger Wert als bisher beizumessen, wäre auf lange Sicht fatal, meint Spohn: „für unser Klima, aber auch unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand“.







